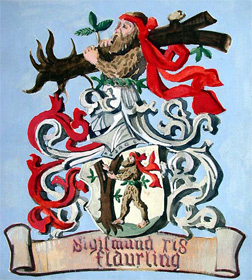Flaurling hat seine Gleichberechtigung mit Pfaffenhofen durch die Jahrhunderte
behauptet, denn der Pfarrer hatte seinen Wohnsitz in Flaurling, seine Pfarrkirche
aber (bis 1788) in Pfaffenhofen. Die Pfarre umfasste das südliche Innufer von Inzing
bis Pfaffenhofen, und ihr Pfarrherr gehörte zu den bedeutendsten im ganzen Tal.
Der weitläufige Pfarrhof am südlichen Waldrand hinter dem Dorf gleicht einer Burg.
Hier residierte in den Jahren von 1479 bis 1526 der Pfarrherr Sigmund Ris. Er war
der Sohn des Sterzinger Bürgers und Kaufmanns Hans Ris, der 1458 die Aufsicht
über die Aufstellung des prachtvollen Altars von Hans Multscher in der Eisackstadt
hatte und auch einen namhaften Betrag dafür spendete.
Die Freude an der Kunst vererbte sich anscheinend auf seinen 1431 geborenen
Sohn Sigmund, der den Priesterberuf wählte und 1479 Pfarrer in Flaurling wurde. Er
hatte diese Verleihung der Gunst des Landesfürsten Erzherzog Sigmunds zu
verdanken, dessen Hofkaplan er war.
Als 58 jähriger und wohlbestallter Pfarrer nahm Ris von 1489 bis 1490 Studienurlaub
und erwarb an der Universität Bologna¹
die Titel eines Magisters der freien Künste und eines Baccalaureus der Heiligen Schrift.
1496 verlieh der alte Erzherzog seinem Hofkaplan ein Wappen "aus ursachen seiner
Erbarkeit, guten Sitten und Mildigkeit, darin er uns berümbt wird". Dieses Wappen
zeigt in Anspielung auf den Namen einen Riesen, der einen Baum spaltet.
¹ Anm. arw: "Beschreibung der Diözese Brixen", Tinkhauser/Rapp, Pfarrbezirk Flaurling, S.9:
"... 1489-1491 ... vielleicht auf der Universität zu Bologna ..." Dagegen ist ein Studienaufenthalt in Wien
gut dokumentiert. vgl. Paul Uiblein "Die Universität Wien im Mittelalter:
Beiträge und Forschungen", S. 401 ff
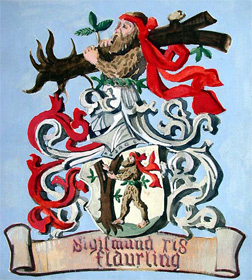
Wappen von Pfarrer Sigmund Ris, nach einem Aquarell von. Mag. Herbert Wachter
Erzherzog Siegmund schenkte seinem Pfarrer auch noch das Jagdschlösschen in
Flaurling, das nun Pfarrer Ris zum Pfarrhof ausbaute.
Im Westen der Pfarrhof, dem man seine Herkunft vom Jagdschloss noch anmerkt,
steht ein zweigeschossiger Bauwürfel mit Erkern und Portalen, hohem Walmdach
und einem spitzen, spätgotischen Turm.
Daran schließt der schmale, turmartige Trakt mit einem großem Erker, die alte
Bibliothek und die Kapelle mit den spitzbogigen Fenstern an. Den östlichen
Abschluss bildet der mit einem Walmdach versehene Baukörper Risenegg, in dem
sich heute Wohnungen und im Erdgeschoss die 1990 eröffnete öffentliche
Pfarrbücherei befinden.
Der Erbauer des ganzen Riskomplexes wie auch der zugleich erneuerten Dorfkirche
war wohl Meister Oswald Klotz aus Inzing, der auch den Brief der Risenstiftung
unterschrieben hat.

Der "Silbergulten Kelch", den Erzherzog Sigismund für Pfarrer Ris fertigen ließ
Der neue Landesfürst, Kaiser Maximilian I., war dem Pfarrherrn von Flaurling
ebenfalls sehr gewogen. Er besserte 1510 sein Wappenzier durch eine Helmzier, die
den Riesen mit einem geschulterten Baum darstellt.
1516 bestätigte Kaiser Maximilian I. die von Pfarrer Ris im Jahr 1504 errichtete
Stiftung, die "ewig der Rysen Stifft" heißen sollte. Sie erhielt einen eigenen Kaplan,
der alle Sonntage in der Kirche zu Flaurling und an 16 Feiertagen in den Kirchen
Pfaffenhofen und Hatting die Messe zu lesen und eine einstündige Predigt auf der
Kanzel zu halten hatte. Außerdem hatte der Kaplan einen ewigen Jahrtag für die
Familie Ris zu halten. Dafür bekam er außer der Besoldung den Ansitz Risenegg als
Wohnung, die dazugehörige Kapelle, einen "Frühmessgarten" und die von Pfarrer
Ris um 1000 Gulden errichtete Bibliothek. Zur Stiftung gehörten noch der silberne
Kelch, "den Erzherzog Sigmund zu Österreich hochlöblicher Gedächtnis mir geben
hat", eine silberne Monstranz, drei Meßgewänder, ein "pergamen" gedrucktes
Meßbuch und die zwei Glocken im Türmchen des Pfarrhofes, die Ris um 36 Gulden
gekauft hatte. Die ganze Umgebung des Risgebäudes wurde mit einem Bauverbot
belegt, "damit in die Gemächer an lufft, liecht, aussehen, Ein- und Ausfahrt kein
Schaden erwachse".
Zur Stiftung gehörte auch die sog. "Risliberey", diese Büchersammlung umfasste 12
Handschriften und 137 Druckwerke, die zum Großteil bis heute erhalten geblieben
sind und teilweise in der Universitätsbibliothek Innsbruck aufbewahrt werden.
Auch Kapital wurde in diese Stiftung eingebracht, so stiftete Pfarrer Sigmund Ris
selbst 525 Gulden, sein Bruder Christian in Sterzing brachte 500 Gulden ein, seine
Schwester Katharina Gföllin spendierte ebenfalls 500 Gulden und die Gemeinde
Flaurling 300 Gulden. Nach dem Willen des Stifters wurde das Kapital so angelegt,
dass es auch künftige Geldentwertungen schadlos überstehen sollte.
Sicher hat Sigmund Ris diese Stiftung als Abschluss seines Lebenswerkes schaffen
wollen, er war damals 85 Jahre alt, aber er überlebte auch den zweiten
Landesfürsten Maximilian, dankte schließlich 1526 als Pfarrer ab und starb erst 1532
im unglaublichem Alter von 101 Jahren als erster hundertjähriger Tiroler, von dem wir
wissen.

Grabstein von Sigmund Ris in der Pfarrkirche Flaurling
Schon zu Lebzeiten (um 1510) hatte er sich einen prachtvollen Grabstein aus rotem
Salzburger Marmor meißeln lassen, ein Werk aus dem Kreis des Bildhauers
Wolfgang Leb in Wasserburg. Er ist heute an der Mauer der Pfarrkirche Flaurling
über seinen Grab eingesetzt.
In der Kapelle ließ Pfarrer Ris 1510 einen
Flügelaltar errichten, der ebenfalls die
Zeiten überlebt hat. Er ist in allen Teilen gemalt und zeigt im Mittelteil die hl. Sippe,
an den Flügeln das Marienleben (Verkündigung, Geburt Christi, Beschneidung und
Anbetung der Könige). An den Außenseiten der Flögel ist links Kaiser Heinrich und
rechts der Herzog Leopold abgebildet. Zu Füßen der beiden Heiligen knien die
Stifter, links der Pfarrer Sigmund Ris mit seinem Wappen, rechts Christian Ris mit
Gattin Margaretha und Schwester Katharina Gföllin.

Ausschnitt Flügelaltar - liegender Stammvater Jesse
Die Predella zeigt den liegenden Stammvater Jesse, von dessen Brust der
Stammbaum zu den Vorfahren Christi auf das Mittelfeld aufsteigt.
Die Signatur R. L. an der Mantelschließe eines Königs lässt sich mit keinem
urkundlichen Malernamen verbinden. Riesige Heiligenscheine, feierliche Haltung und
steife langbahnige Stoffe kennzeichnen den Maler. In den Szenen des Marienlebens
klingt eine intime Stimmung an, die Parallelen zur Donauschule hat. Der von Pfarrer
Maximilian Wagner errichtete Seitenaltar wurde 1752 konsekriert. Das Altarbild des
Altars zeigt die Heilige Notburga, die bis jetzt einzige weibliche Tiroler Heilige. Das
Bild stammt vom Barockmaler Christoph Anton Mayr aus Schwaz und ist nach
Ansicht des bekannten Volkskundlers Dr. Josef Ringler eines der besten
Notburgabilder des Künstlers.

Wappenstein von Sigmund Ris neben dem Eingang in der Riskapelle
Weitere bemerkenswerte Kunstwerke sind der Wappenstein von Sigmund Ris beim
Eingang der Kapelle und die aus dem 18. Jahrhundert stammende Orgel, die später
durch den Orgelbauer Weber aus Oberperfuß ihre heutige Gestalt erhielt.
Nach der 1972 durch Hubertus von Kerssenbrock erfolgten Restaurierung wurde die
Orgel dem Peter - Anich - Museum in Oberperfuß als Leihgabe überlassen und dann
im Jahr 1987 wieder heimgeholt.
Quellennachweis:
Dr. Erich Egg: "Das Risenstift in Flaurling",
Dehio-Handbuch "Tirol",
Tinkhauser-Rapp: "Beschreibung der Diözese Brixen",
OSR Hans Schweigl: "Die Botschaft der Glocken",
Pfarrbrief von Pfarrer HH Helmut Zingerle,
Prof. A. Reichling: Über die Weberorgel in Flaurling,
Notizen von August von Tabarelli,
Diverse Zeitungsberichte
Foto und Zusammenstellung: Hans Eder